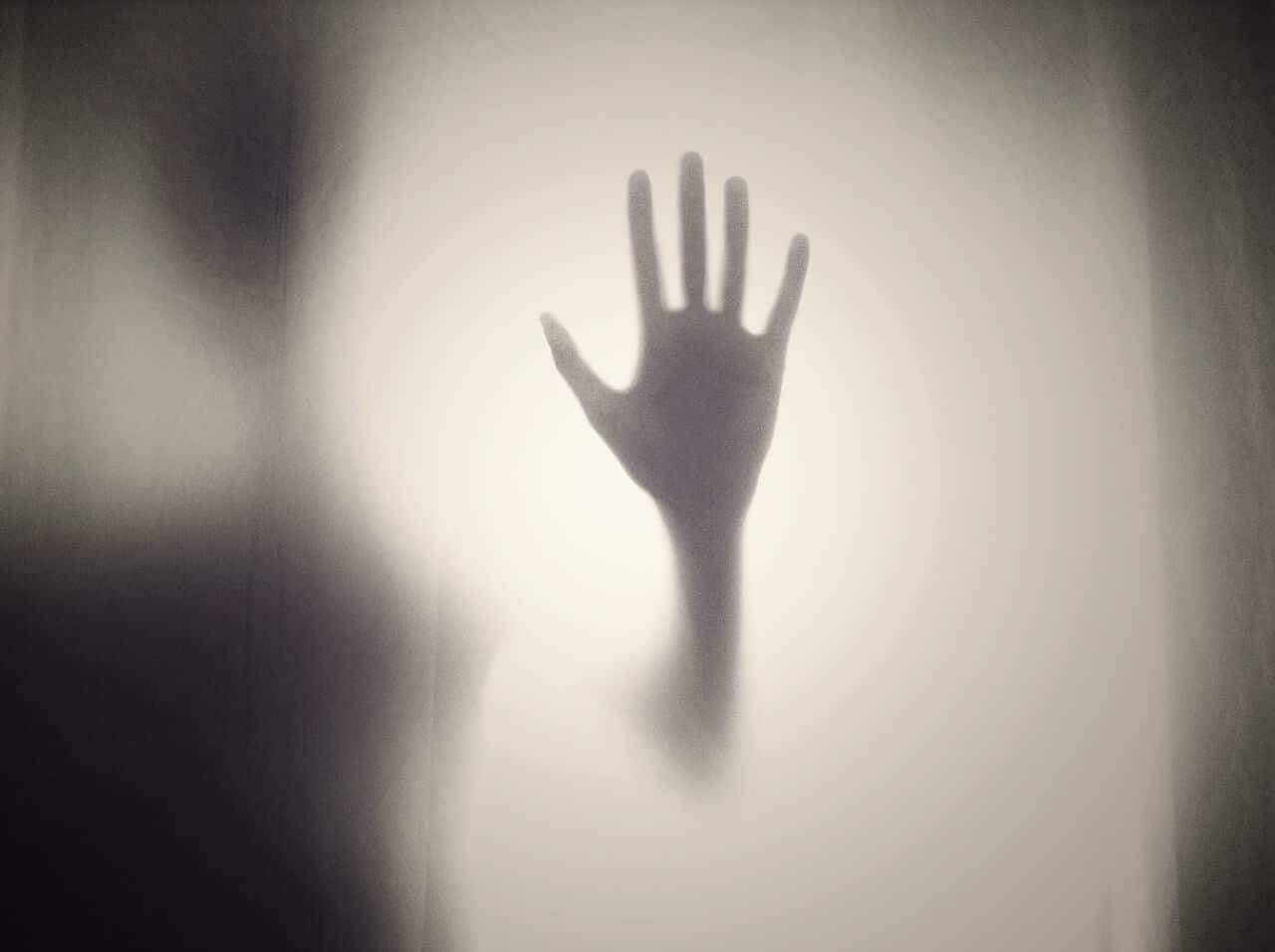[toc]
Die Welt der Angststörungen (Phobien) ist sehr komplex und betrifft mehr Menschen als es zunächst den Anschein hat. Schätzungen zufolge leiden etwa 20 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung unter leichten bis schwereren Formen von phobischer Angst. Dabei sind Frauen etwa doppelt so oft betroffen wie Männer. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick zu verschiedenen Arten der Phobie geben und ergründen, wie eine Angststörung zustande kommt.
Was genau ist eine Phobie?

Eigentlich sind Ängste eine natürliche emotionale Reaktion auf Situationen, in denen Menschen um ihre körperliche oder seelische Unversehrtheit besorgt sind. Die Angst gehört also zum natürlichen Überlebensinstinkt. Katastrophen, Unfälle oder gewalttätige Auseinandersetzungen sind hier die besten Beispiele für eine greifbare und logisch nachvollziehbare Angst.
Phobien zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass Angstzustände ohne erkennbaren Grund entstehen und dabei äußerst extreme Ausmaße annehmen. Die Patienten steigern sich meist so stark in ihre Angst hinein, dass sie konsequent jedwede Situation vermeiden, in der es zur Bewahrheitung ihrer Ängste kommen könnte. In manchen Fällen geht das Vermeidungsverhalten der Phobiker so weit, dass sich Betroffene vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und ihr Dasein lieber in selbstgewählter Isolation fristen, als das Risiko einzugehen, dass sich ihre Angst bewahrheitet.
Abzugrenzen sind echte Phobien von Aversionen. Diese werden ebenfalls gerne mit dem Wortzusatz „-phobie“ belegt, stellen in Wahrheit aber lediglich Abneigungen, Ablehnungen oder Vorurteile eines Menschen gegen bestimmte Situationen, Dinge oder Personengruppen dar. Ein gutes Beispiel sind hier Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit), Homophobie (Schwulenfeindlichkeit) und Islamophobie (Muslimenfeindlichkeit). Auch Geschmacksaversionen gegen bestimmte Lebensmittel sind keine Phobien im eigentlichen Sinne.
Ursachen und Ausprägungen der phobischen Angst
Die Ursachen für Phobien finden sich häufig in bestimmten Schlüsselereignissen. Diese haben bei Betroffenen zu einem bleibenden seelischen Trauma und damit einer Angst vor wiederholtem Eintreten des Ereignisses geführt. Gerade Kindheitstraumata entwickeln hierbei oft eine phobische Eigendynamik. Diese hält selbst im Erwachsenenalter noch an wird ohne geeignete Gegenbehandlung stetig schlimmer. Spezifische Ursachen für eine phobische Angst lassen sich dabei am besten anhand der verschiedenen Phobieformen selbst erklären:
-
- soziale Phobien
Sozialphobien sind die häufigsten und gleichzeitig auch vielfältigsten Phobien unserer Zeit. Charakteristisch für soziale Phobien ist dabei die Angst vor der Beurteilung, den Erwartungen oder den Reaktionen anderer Personen, beziehungsweise davor, deren Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dabei ist für die Angst nicht immer ausschlaggebend, ob die Form der Aufmerksamkeit positiv oder negativ ist. Soziale Situationen, in denen das persönliche Handeln zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird, können ebenfalls eine soziophobische Angst auslösen.
Ihre Ursachen haben Sozialphobien meist in traumatischen Erlebnissen, die sich in der Vergangenheit während sozialen Interaktionen ereignet haben. Immer wieder ist zum Beispiel Mobbing oder die Bloßstellung durch andere – auch Eltern oder Geschwister – für die Entstehung sozialer Phobien verantwortlich. Des Weiteren kommen sexueller Missbrauch (v.a. bei Contrelto- und Coitophobie), häusliche Gewalt und peinliche Situationen wie das Einnässen oder Stottern in der Öffentlichkeit als Ursachen für eine soziophobische Angst in Frage. Beispiele für diese Art der Phobien sind:
-
-
- Anthropophobie – generelle Angst vor Menschen
- Androphobie – Angst vor Männern
- Gynophobie – Angst vor Frauen
- Demophobie – Angst vor großen Menschenansammlungen
- Glossophobie – Angst, mit Menschen zu sprechen
- Logophobie – Angst vor dem Sprechen an sich
- Gelotophobie – Angst davor, ausgelacht zu werden
- Erythrophobie – Angst vor dem Erröten
- Hypegiaphobie – Angst vor Verantwortung
- Bindungsphobie – Angst vor Verantwortung in einer Beziehung
- Kairophobie – Angst vor Entscheidungen
- Neophobie – Angst vor Neuerungen
- Methatesiophobie – Angst vor Veränderung oder Erfolg
- Scholionophobie – Angst vor der Schule
- Paruresis – Angst vor dem Urinieren auf öffentlichen Toiletten
- Coitophobie – Angst vor Geschlechtsverkehr
- Contreltophobie – Angst vor sexuellem Missbrauch
- Coulrophobie – Angst vor Clowns
- Räumliche Phobien
-
Diese Ängste werden gerne mit sozialen Phobien verwechselt. Vor allem die Angst vor Menschengedränge lässt hier irrtümlicher Weise häufig an eine Angst vor Kontakt mit Menschen denken. Tatsächlich ist es aber nicht der soziale Kontakt selbst, sondern die Anhäufung von Personen auf kleinem oder großem Raum, die räumliche Phobien hervorruft.
Ursächlich für diese Form von phobischer Angst können unter anderem die Erinnerungen an beklemmende Gefühle sein, wie sie durch eine Inhaftierung, Hausarrest oder einengendes Kontrollverhalten Dritter entstehen. Ebenso kommt das Gefühl des „sich verloren“ oder „verlassen“ Fühlens als Grund für räumliche Phobien in Frage. Beklemmende Gefühle führen in diesem Zusammenhang meist zu einer Angst vor kleinen Räumen, wohingegen das Gefühl des Verlorenseins eher eine Angst vor weiten, offenen Plätzen erzeugt. Unterschieden wird bei der räumlichen Phobie demgemäß zwischen zwei Hauptformen:
-
-
- Agoraphobie – Angst vor weiten Plätzen
- Klaustrophobie – Angst vor engen Räumen
- Hypochondrie
-
Als Hypochonder bezeichnet man Menschen, die eine besondere Angst vor dem Krankwerden haben. Hervorgerufen wird die Hypochondrie gemeinhin durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Krankheit. Medizinstudenten und medizinisches Fachpersonal, aber auch Autoren von Medizinartikeln und Abonnenten medizinischer Fachzeitschriften gehören hierbei zu den Risikogruppen von Hypochondrie.
In der Neuzeit etablierte sich zudem der Begriff Cyberchondrie. Er beschreibt die Entstehung hypochondrischen Verhaltens durch das stetige Lesen von Ratgebern über Krankheiten und Symptome im Internet. Zu den gängigen Formen von hypochondrischer Angst gehören:
-
-
- AIDS-Phobie – Angst, sich mit HIV zu infizieren
- Bakteriophobie – Angst vor Bakterien
- Bazillophobie – Angst vor Mikroben
- Dermatophobie – Angst vor Hauterkrankungen
- Kardiophobie – Angst vor Herzerkrankungen
- Karzinophobie – Angst vor Krebs
- Mysophobie – Angst vor der Keimübertragung
- Parasitophobie – Angst vor Parasiten
- Phobie vor Körperprozessen und Angst vor dem Körperverfall
-
Einige Phobien treten bewusst dann auf, wenn es um körpereigene Prozesse oder die Vergänglichkeit des Körpers geht. Ein gutes Beispiel ist hier die Schwangerschaftsangst. Was für die meisten Frauen eine aufregende Phase des weiblichen Lebens ist, bereitet manchen Vertretern des schönen Geschlechts unglaubliche Panik. Diese kann bis hin zu einer phobischen Angst vor Fehlgeburten oder dem Geburtsprozess an sich führen. Ähnlich panisch reagieren zahlreiche Phobiker beim Thema Blutfluss. Den roten Lebenssaft direkt vor Augen zu haben, und sei es nur in Form eines einzigen Bluttropfens, ist für sie der pure Horror.
Angstauslösenden Ekel vor dem eigenen Körpergeschehen empfinden dagegen Menschen mit Coprophobie. Hierbei handelt es sich um eine Phobie, welche die ekelbedingte Angst vor Exkrementen beschreibt. Das Gegenteil ist hier die Sitophobie, welche Ekel und Angst vor unverdautem Essen definiert. Den Körper als ein veränderliches und auch vergängliches Objekt zu begreifen, ist für einige Phobiker also definitiv zu viel. Gleichwohl können auch reale Gesundheitsprobleme die Angst vor Körperprozessen oder der Mortalität befördern. Hier noch einmal ein Überblick zu entsprechenden Körperphobien:
-
-
- Tokophobie – Angst vor einer Schwangerschaft oder Geburt
- Abortphobie – Angst vor einer Fehlgeburt
- Emetophobie – Angst vor dem Erbrechen
- Dysmorhophobie – Angst vor Entstellung
- Sitophobie – Angst vor Nahrung oder Nahrungsaufnahme
- Coprophobie – Angst vor Exkrementen
- Hämatophie – Angst vor Verletzungen oder dem Anblick von Blut
- Gerontophobie – Angst vor Greisen oder der eigenen Alterung
- Kopophobie – Angst vor Müdigkeit oder dem Einschlafen
- Nekrophobie – Angst vor Toten oder dem Tod
- Taphephobie – Angst vor Friedhöfen oder davor, lebendig begraben zu werden
- Angst vor Schmerz und Berührung
-
Jemandem zu unterstellen, er habe Berührungsängste, weil er schüchtern oder zurückhaltend ist, lässt manchmal übersehen, dass es auch echte Phobien vor dem Berühren gibt. Sie entstehen gerne nach einem Gewalttrauma oder in Kombination mit Hypochondrie. Des Weiteren sind bestehende Grunderkrankungen, die schon bei geringster Berührung starke Schmerzen verursachen (z.B. Schmetterlingskrankheit oder Nervenerkrankungen), als Ursache für Berührungsangst denkbar. Ebenfalls häufig beobachtet werden Phobien dieser Art bei Menschen mit Autismus.
Apropos Schmerz – Die Angst vor einer Zahnbehandlung (Odontophobie) oder einer Spritze (Trypanophobie) lässt sich in gewisser Weise ebenfalls zu den Berührungsängsten zählen, denn wovor Patienten hier am meisten Angst haben, ist der Kontakt zwischen Arztbesteck und ihrem Körper. Hier die drei wichtigsten Formen der Berührungsängste:
-
-
- Aphephosmophobie – generelle Angst vor der Berührung durch andere Lebewesen
- Chiraptophobie – Angst, berührt zu werden
- Haptophobie – Angst, sich durch Berührung anzustecken
- Odontophobie – Angst vor Zahnbehandlungen oder Dentalbesteck
- Trypanophobie – Angst vor Spritzen
- Zoophobien
-

Diese Ängste richten sich gegen verschiedene Tiere. Meist ist dabei ein bestimmtes Tierverhalten oder Aussehen des Tieres für die Phobie verantwortlich. Nicht selten gehen Zoophobien auch mit Hypochondrien, Berührungsängsten oder einer Aversion gegen das Gefühl einher, das verschiedene Tiere bei Hautkontakt hervorrufen.
Ebenfalls als Ursache für Zoophobie denkbar ist die Assoziation eines Tieres mit einer Gefahrensituation. Kam es in der Vergangenheit zum Beispiel zu gefährlichen Auseinandersetzungen mit einem Tier, kann diese Erfahrung als angst- oder aversionsauslösende Erinnerung im Gedächtnis gespeichert sein. Gleiches gilt für lebensbedrohliche Situationen, in denen ein Tier anwesend war (z.B. ein Unfall). Zu den bekanntesten Zoophobien gehören:
-
-
- Aelurophobie – Angst vor Katzen
- Akarophobie – Angst vor Insekten oder Insektenstichen
- Aracnophobie – Angst vor Spinnen
- Canophobie – Angst vor Hunden
- Herpetophobie – Angst vor Reptilien
- Ornithophobie – Angst vor Vögeln
- Naturphobien und Angst vor Umweltreizen
-
Natur und Umwelt halten für Phobiker zahlreiche, furchteinflößende Reize bereit. Von verschiedenen Wetterphänomenen bis hin zu beängstigenden Landschaftseindrücken kommen hier diverse Gründe für eine phobische Angst in Betracht. Die Furcht kommt in solchen Fällen gerne einer überzogenen „Ehrfurcht“ vor Naturgewalten gleich.
Als Auslöser derartiger Phobien ist abermals eine kindliche Angst vor Dingen und Situationen von Bedeutung, denen man sich hilflos ausgeliefert fühlte. Daneben seien nachvollziehbare Ursachen für Natur- und Umweltphobien erwähnt, beispielsweise eine miterlebte Naturkatastrophe oder Schrecksekunde aufgrund von Umweltreizen. Insgesamt lassen sich zu dieser Art von spezifischen Phobien folgende Angststörungen zählen:
-
-
- Achluophobie – Angst vor der Dunkelheit
- Photophobie – Angst vor Licht
- Radiophobie – Angst vor radioaktiver Strahlung
- Phonophobie – Angst vor Geräuschen
- Keraunophobie – Angst vor Blitz und Donner
- Pluviophobie – Angst vor Regen
- Nephelophobie – Angst vor Wolken
- Cheimaphobie – Angst vor Kälte
- Xylophobie – Angst vor Holz
- Hylophobie – Angst vor Wäldern
- Anthophobie – Angst vor Blumen
- Siderodromophobie – Angst vor Zügen oder Schienen
- Gephyrophobie – Angst vor dem Überqueren von Brücken
- Aviophobie – Flugangst
- Akrophobie – Höhenangst
- Sonstige phobische Störungen
-
Einige Phobien sind in der Medizin nicht näher definiert. Ihnen ist aber gemeinsam, dass sie besonders ungewöhnlich erscheinen. Dazu gehören vor allem:
-
- Tetraphobie – Angst vor der Zahl Vier
- Tridecaphobie – Angst vor der Zahl Dreizehn
- Paraskavedekatriaphobie – Angst vor Freitag, dem 13.
- Ikonophobie – Angst vor Bildern bzw. der Ablehnung durch personelle Bildnisse
- Phobophobie – Angst vor der Angst selbst
Symptome bei Phobien
Die Symptome einer Phobie sind trotz der vielschichtigen Ausprägungsformen oftmals die Gleichen. Klassische Symptome sind:
- Atembeschwerden
- Beklemmungsgefühle
- Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen
- Gefühl, vor Angst zu sterben
- Herzklopfen
- erhöhter Puls
- Herzklopfen
- Hitzewallungen
- Mundtrockenheit
- Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
- Panikattacken
- Schmerzsymptome
- Schweißausbrüche
- Schwindel
- Sprachstörungen
- Zittern
- Zweifeln am eigenen Verstand
Noch schlimmer als die akuten Symptome sind aber die Langzeitfolgen einer Phobie. Zum einen neigen Menschen mit phobischer Angst dazu, sich sozial zu isolieren, was zu großen Problemen im Privat- und Berufsleben führt. Zudem wird eine Phobie erfahrungsgemäß stetig schlimmer, wenn sie keine Behandlung erfährt. Dies kann so weit gehen, dass ein Phobiker irgendwann keinen Fuß mehr vor die Haustüre setzt, um sich sämtlichen Sozial- und Umweltreizen zu entziehen. Die Folgen dieses Vermeidungsverhaltens sind dann nicht selten Arbeitslosigkeit, Depressionen und eine erhöhte Suizidgefahr. Auch Verfolgungswahn kann im Zuge einer anhaltenden phobischen Störung auftreten.
Diagnose und Behandlung bei Phobien

Eine Phobie erfordert immer ein ausführliches Patientengespräch mit einem Psychologen. Die Ursachen der Angst müssen in einer sorgfältigen Gesprächstherapie ermittelt werden. Zusätzlich können körperliche Untersuchungen mögliche Krankheiten zutage fördern, wie sie zum Beispiel bei einigen Berührungsängsten gegeben sind. Für die Behandlung einer Phobie gibt es dann nur eine Lösung:
- Verhaltenstherapie: Der Phobiker muss in einer speziellen Therapiemaßnahme Verhaltensweisen erlernen, mit denen er seiner Angst rational begegnen kann. Für Sozialphobien bedeutet dies auch häufig das Erlernen grundlegender Sozialfähigkeiten. Auch der Selbstwert des Patienten muss in solch einem Fall gestärkt werden.
- Konfrontationstherapie: Einen Phobiker mit jenen Ängsten zu konfrontieren, die ihn belasten, ist der zweite Schritt einer erfolgreichen Therapie. Unter Betreuung und Anleitung werden hier die angstauslösenden Situationen also bewusst aufgesucht und bewältigt. Dabei müssen die Anforderungen nach und nach angehoben werden, bis der Betroffene dazu imstande ist, entsprechende Situationen alleine zu meistern.
- Entspannungstherapie: Ein Mensch mit Phobie steht unter ständiger Anspannung. Seine Ängste lassen weder Körper noch Geist zur Ruhe kommen, was die ruhige und sachliche Auseinandersetzung mit seinen Ängsten deutlich erschwert. Entspannungsübungen wie Yoga, autogenes Training, Meditation oder auch Hypnose tragen hier nicht nur zur allgemeinen Beruhigung bei, sondern helfen dem Phobiker gleichzeitig, in belastenden Situationen kühlen Kopf zu bewahren.
Phobien – Verlauf, Komplikationen und Prävention
- Dank professioneller Therapieanleitung können Personen mit einer phobischen Störung häufig vollständig von ihrer Phobie erlöst werden. Ohne geeignete Behandlung ist dagegen eine Verschlimmerung der Angststörung zu erwarten.
- Komplikationen entstehen bei Phobien maßgeblich durch den Teufelskreis, der sich aus dem Hineinsteigern in die eigenen Ängste und dem damit verbundenen Vermeidungsverhalten ergibt. Soziale Isolation und berufliche Probleme sind hier ebenso problematisch wie die zunehmende Verzweiflung und Hilflosigkeit, mit der sich Phobiker konfrontiert sehen. Insgesamt können krankhafte Ängste das Alltagsleben stark beeinträchtigen.
- Vorbeugen lässt sich Angststörungen nur bedingt. Leider wissen die meisten Betroffen oft selbst nicht um das volle Ausmaß ihres Traumas und auch die nötigen Verhaltensweisen zur Vermeidung phobischer Störungen müssen in der Regel erst erlernt werden. Traumatische Erlebnisse frühzeitig mit therapeutischer Hilfe aufzuarbeiten, ist darum wohl die einzige, um Phobien präventiv zu behandeln.
Fazit
Phobien sind im Großteil aller Fälle die Folge eines traumatischen Erlebnisses, wobei die Angststörung eine Überreaktion der Psyche auf das angstauslösende Trauma darstellt. Im Grunde kann jede Situation, jede soziale Erfahrung und auch jeder Umweltreiz eine Phobie auslösen. Das beste Mittel gegen die Angststörung ist dabei eine konsequente Verhaltens- und Konfrontationstherapie, die den Phobikern hilft, ihre übertriebenen Ängste sachlicher zu beurteilen und sich ihnen mutig entgegen zu stellen, anstatt vor ihnen davon zu laufen.