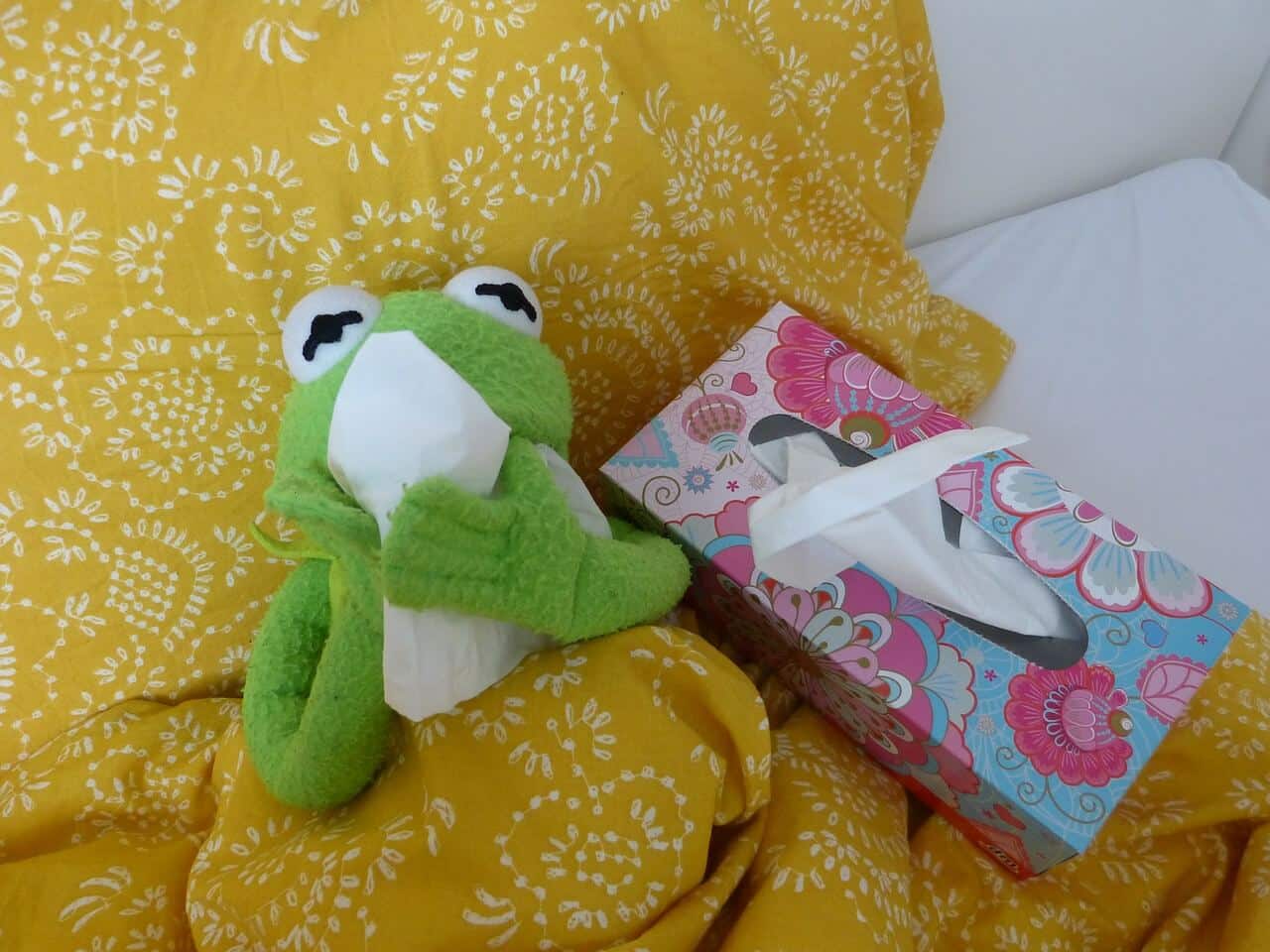Ungewöhnliche Veränderungen des Auges, die ganz gezielt aus einer Pupillenverengung, einem herabhängenden Oberlid und einem eingesunkenen Augapfel bestehen, gelten als einschlägige Symptome des sogenannten Horner-Syndroms. Dieses wurde im Jahre 1869 erstmals durch den Schweizer Augenarzt Johann Friedrich Horner beschrieben, welcher dem Syndrom auch seinen Namen verlieh. In Erscheinung treten kann das Horner-Syndrom als Folge zahlreicher Vorerkrankungen. In diesem Ratgeber möchten wir besagte Ursachen ebenso wie die genauen Abläufe und Methoden der Behandlung des Syndroms etwas genauer beleuchten.
Entstehung des Horner-Syndroms

Um die Entstehung des Horner-Syndroms nachvollziehen zu können hilft es, jene Nerven zu betrachten, welche für die Funktionalität von Augenreflexen verantwortlich sind. Egal ob nun die Erweiterung und Verkleinerung der Pupillen oder Bewegungen und Haltepositionen der Augenlider und des Augapfels – alle der genannten Funktionen werden maßgeblich durch ein komplexes Zusammenspiel von Nerven gewährleistet, welche zwischen Auge und Hypothalamus bzw. Auge und Hirnstamm verlaufen. Kommt es nun zu Funktionsausfällen in diesem sensiblen Nervenbereich, so kann dies die Augen- und Sehfunktion nachhaltig beeinträchtigen. Im Detail sind es Schäden am unwillkürlichen Nervensystem (Sympathikus), die das Syndrom auslösen und in Folge für Muskelstörungen und die bereits erwähnte Symptomtrias, bestehend aus Pupillenverengung (Miosis), hängendem Oberlid (Ptosis) und Einsinken des Augapfels (Enophthalmus) sorgen.
Zustande kommt der Symptomkomplex aus Miosis, Ptsosis und Enophthalmus durch fortschreitende Ausfälle sympathischer Nerven, die allerdings nicht zwingend entlang der oben beschriebenen Strecke zwischen Augen, Hypothalamus, Hirnstamm und Rückenmark verlaufen müssen. Ebenso kann es sein, dass andere Nerven im Hals- und Kopfbereich von Schädigungen betroffen sind, die sich dann erst im späteren Verlauf auf die Nervenstränge im Augenbereich ausweiten. Es wird ersichtlich, dass die Entstehungswege des Horner-Syndroms sehr vielseitig sind.
Ursachen für das Horner-Syndrom
Krankheiten, die das Horner-Syndrom hervorrufen können, gibt es viele. Daneben sind auch Verletzungen als Ursache der Nervenstörung nicht ausgeschlossen. Hier eine kleine Übersicht:
- Infektionskrankheiten: Zu den Infektionen, die sich schädlich auf sympathische Nerven auswirken können, gehört vor allem die auch als Gürtelrose bekannte Krankheit Herpes Zoster. Sie wird durch den Virus Varizella Zoster ausgelöst und kann bei Erwachsenen als Sekundärinfektion einer Windpockenerkrankung im Kindesalter auftreten. Sollten sich die Viren im Bereich der hals- und kopfeigenen Nerven ansiedeln, ist ein Horner-Syndrom als Krankheitskomplikation nicht auszuschließen. Ein noch größeres Risiko besteht bei Gesichtsrose, einer Sonderform der Gürtelrose, welche gezielt die Nerven im Gesichtsbereich betrifft.
- Krebserkrankungen: Im Bereich der Krebskrankheiten sind es vor allem Bronchial-, Schilddrüsen- und Speiseröhrenkarzinome, die aufgrund ihrer Nähe zu kopfeigenen Nerven die Gefahr eines Horner-Syndroms erhöhen. Darüber hinaus seien auch Neuroblastome als mögliche Ursache für das Syndrom erwähnt. Als Krebserkrankung des Nervensystems bergen sie das größte Risiko auf neurologische Komplikationen. Das Horner-Syndrom tritt diesbezüglich in 15 bis 20 Prozent aller Fälle von Neuroblastomen im Halsbereich auf.
- Schilddrüsenerkrankungen: Neben Schilddrüsenkrebs gibt es noch einige weitere Erkrankungen der Schilddrüse, die mit dem Horner-Syndrom in Verbindung gebracht werden. Allen voran ist es eine krankhafte Vergrößerung der Schilddrüse in Form eines Kropfes. Ähnlich wie ein Tumor kann auch ein Kropf je nach Größe benachbarte Nerven einklemmen und so für neuronalen Ausfällen sorgen.
- Gefäßerkrankungen: Geht es um Gefäßkrankheiten, gibt es besonders viele Ursachen, die theoretisch zu einem Horner-Syndrom führen. Außer Durchblutungsstörungen kommen diesbezüglich auch Gefäßblockaden (z.B. arterielle Verschlüsse), Gefäßaneurysmen und arterielle Dissektionen als Ursache des Syndroms in Frage.
- Verletzungen: Sollte eine Verletzung zu Schäden am Rückenmark, der Brust- oder Halswirbelsäule führen, so ist dies ein weiterer, denkbarer Grund für das Syndrom. Ebenso seien Nervenentzündungen erwähnt, die größere Schäden an den betroffenen Nerven hinterlassen.
Symptome bei Horner-Syndrom
Neben den zu Beginn erwähnten Symptomen aus Miosis, Ptosis und Enophthalmus gibt es noch einige andere Beschwerden im Bereich der Augen, die auf das Syndrom hinweisen können. Zudem sprechen auch einige unspezifische Beschwerden für ein Vorliegen des Syndroms. Grundsätzlich müssen Sie auf folgende Symptome achten:
- allgemeine Sehstörungen
- verengte Pupillen (Miosis)
- abweichende Pupillenweite
- Farbunterschiede im Bereich der Regenbogenhaut
- Pigmentflecken im Auge
- herabhängendes Oberlid (Ptosis)
- eingesunkener Augapfel (Enophthalmus)
- Muskellähmungen
- veränderter Gesichtsausdruck
- Gefäßerweiterungen (Vasodilatation)
- Schweißausbrüche
- verminderte Schweißsekretion im Gesicht (Anhidrose)

Diagnose und Behandlung bei Horner-Syndrom
Feststellen lässt sich das Syndrom zum einen durch Untersuchung des Patienten auf die drei Kardinalsymptome. Demnach erhärtet sich ein Verdacht auf Horner-Syndrom, wenn der Augapfel erkennbar in die Augenhöhle eingesunken ist, ein auffällig herabhängendes Oberlid selbst bei gezieltem Kraftaufwand kaum angehoben werden kann und eine Pupille dauerhaft kleiner erscheint als die andere. Die betroffene Pupille erweitert sich auch bei konkretem Lichteinfall nur langsam, was ebenfalls Hinweise auf das Syndrom liefert.
Neben diesen, durch Blickdiagnose erkennbaren Anzeichen gibt es einen speziellen Augentest, der bei Verdacht auf Horner-Syndrom zum Einsatz kommt. Der Test sieht eine Gabe von kokain- und amphetaminhaltigen Augentropfen vor, welche die Pupillen im Normalfall zur Erweiterung anregen. Liegt ein Syndrom nach Horner vor, weichen die Seitendifferenzen der Pupillenweite jedoch selbst eine Stunde nach Verabreichung der Augentropfen noch stark von der Norm ab.
Horner-Syndrom – Verlauf, Komplikationen und Prävention

- Der Verlauf des Syndroms hängt von der zugrundeliegenden Erkrankung ab. In den meisten Fällen kann durch Behandlung der Grunderkrankung aber eine Besserung, wenn nicht sogar eine vollständige Heilung erzielt werden.
- Wichtig ist, das Syndrom rechtzeitig zu behandeln, da es ansonsten zu irreparablen Schäden an Nerven und Auge kommen kann. Bleibende Sehstörungen sind in solch einem Fall nicht mehr auszuschließen.
- Dem Horner-Syndrom vorzubeugen ist nahezu unmöglich. Einzig Verletzungen der Nerven (z.B. durch Unfälle) und manche Gefäßerkrankungen als lassen sich als Ursache durch eine umsichtige Lebensweise vermeiden.
Fazit
Das nach dem Schweizer Augenarzt Johann Friedrich Horner benannte Horner-Syndrom ist ein seltener Symptomkomplex, der maßgeblich aus einer verengten Pupille, einem herabhängenden Oberlid und einem eingesunkenen Augapfel besteht. Die Symptomtrias tritt im Zuge verschiedener Krankheiten auf, welche zu Schäden oder Störungen jener sympathischen Nerven führen, die unmittelbar mit dem Auge verbunden sind. Leider lässt sich das Syndrom nur durch Therapie der Grunderkrankung beheben. Dies sollte bei eindeutigen Anzeichen auch sehr frühzeitig geschehen, um bleibende Augenschäden zu vermeiden.