
Unter Berücksichtigung aller Knochenbrüche ist der Beckenbruch (Beckenfraktur) mit 0,3 bis 1,6 Prozent nicht besonders häufig vertreten. Dies liegt einerseits daran, dass das Becken sehr stabil und gerade bei Jugendlichen noch sehr elastisch ist, was einem Bruch meist vorbeugt. Andererseits werden viele stabile Beckenbrüche aber durch ungenügende Röntgenuntersuchungen der Beckenknochen oft erst gar nicht bemerkt. Erfahren Sie hier mehr zum Thema Beckenbruch.
Was ist ein Beckenbruch? – Einzelheiten zur Fraktur des Beckens
Der robuste Beckenknochen (Pelvis) ist nicht umsonst in der Körpermitte des Menschen verankert. Hier stützt er die Gedärme, sorgt für eine richtige Beinstellung und garantiert dem Haltungs- und Bewegungsapparat die nötige Stabilität. Zudem stellt das Becken einen essenziellen Part des sogenannten Beckengürtels (Cingulum membrum pelvini), auch als Beckenring bekannt. Dieser setzt sich aus folgenden Knochenelementen zusammen:

- Kreuzbein (Os sacrum)
- linkes und rechtes Hüftbein (Os coxae)
- Darmbein (Os ileum)
- Schambein (Os pubis)
- Sitzbein (Os ischii)
Nach oben ist das Becken über den Lendenwirbel mit der Wirbelsäule verbunden. Nach unten hin schließen die Oberschenkelknochen der Beine an die beiden Hüftbeine an. Des Weiteren gibt es einen signifikanten unterschied zwischen dem weiblichem und männlichem Beckenknochen. So sind die beiden Beckenschaufeln der Frau beispielsweise wesentlich ausladender, was in erster Linie auf die Gebärfähigkeit zurück geht. Ähnliche Kriterien formen auch die weibliche Schambeinfuge, deren Winkel größer als 90° ist. Anders sieht es beim Becken des Mannes aus. Dieses ist nicht nur schmaler sondern weist auch einen geringeren Schambeinfugenwinkel von weniger als 90° auf.
Was nun den Beckenbruch anbelangt, so ist dieser ein häufiger Begleiter von schweren Unfällen oder Stürzen aus großer Höhe, bei denen eine massive Druckeinwirkung bzw. Erschütterung auf den Beckenring einwirkt. Unterschieden werden hierbei drei Arten von Beckenbrüchen:
Typ A – stabiler Beckenbruch: Bei der stabilen Beckenverletzung kommt es zu einem Bruch an oberflächlichen Bereichen des Beckens, wie dem Sitzbein, Schambein oder Steißbein. Die Teil- oder Komplettbrüche sind zwar schmerzhaft, provozieren aber keine Deformation des Beckens. Eine vollständige Ausheilung ist bei einem stabilen Beckenbruch meist möglich.
Typ B – rotationsinstabiler Beckenbruch: Die rotationsinstabile Beckenringverletzung, die durch Verletzungen der Beckenfront entsteht, sorgt häufig dafür, dass sich die eigentlich unbeweglichen Beckenschaufeln nach außen aufklappen lassen. Das Becken wird bei einer derartigen Fraktur also beweglich, was einen Stabilitätsverlust, sowie folgenschwere innere Blutungen verursachen kann.
Typ C – vertikal und rotationsinstabiler Beckenbruch: Liegt eine rotations- und vertikal instabile Beckenringverletzung vor, wurde der Beckenring an der Vorderseite, sowie an der Schambeinfurche, welche die beiden Beckenhälften zusammenhält, komplett gebrochen. Lebenslange Haltungsschäden sind bei einem solchen Bruch nicht auszuschließen, da eine vollständige Restabilisierung des Beckens nicht zwingend gewährleistet ist.
Ursachen für eine Beckenfraktur
Die Gefahr, einen Beckenbruch zu erleiden, besteht vor allem für ältere Menschen, da entsprechende Frakturen oft im Zusammenhang mit altersbedingten Knochenerkrankungen wie Osteoporose auftreten. Doch auch in jungen Jahren kann die Stabilität der Beckenknochen beeinträchtigt werden. Hier ein kleiner Überblick über mögliche Ursachen:
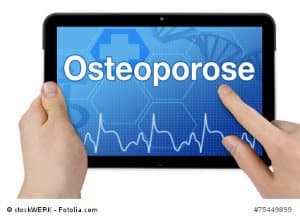
Osteoporose: Mit einem Anteil von 95 % entwickelt sich die Osteoporose als eigenständige Erkrankung und betrifft zu 80 % Frauen nach der Menopause. Wenn Sie häufig unter sehr intensiven, lange andauernden Rückenschmerzen leiden oder an sich eine schleichende Reduzierung der Körpergröße bemerken, sollten Sie deshalb unbedingt einen Arzt kontaktieren. Der Schwund der Knochendichte sorgt nämlich dafür, dass die Knochen Ihres Körpers an Volumen verlieren. Auch der Beckenknochen erleidet durch Osteoporose schneller eine Fraktur und macht dabei eine Behandlung oft langwierig und mühsam.
Unfälle: Das Becken bildet zusammen mit der Wirbelsäule den Stabilisierungsapparat des Körpers. Alltägliche Stöße durch einfache Schritte, kleine Hüpfer oder dergleichen werden durch die Bandscheiben und Wirbel der Wirbelsäule zuverlässig abgefangen und gedämpft. Durch massive Krafteinwirkung (z.B. bei einem Autounfall oder Sturz) ist der Körper jedoch oftmals nicht mehr in der Lage, die Druckeinwirkung ausreichend abzufedern. Der Druck wirkt daher direkt auf die Beckenknochen ein, welche daraufhin einen Bruch erleiden.
genetische Disposition: Manche genetisch bedingte, entzündliche Gelenkerkrankungen (beispielsweise Morbus Bechterew) lassen den Bewegungsapparat versteifen oder beeinträchtigen allgemein die Bewegungsfreiheit, was die Sturzgefahr durch Immobilität des Betroffenen stark erhöht. Durch die daraus resultierenden Unfälle kann es zu Brüchen oder Verschiebungen des Beckens kommen.
Welche Symptome verursacht ein Beckenbruch?
Viele Symptome in der Region des Beckenrings können auf einen Beckenbruch hindeuten. Vielleicht haben sich Ihre Sehnenansätze schmerzhaft entzündet oder Alltagsbewegungen verursachen Schmerzen im Bereich der Hüfte? Bedenken Sie, eine stabile Fraktur verursacht häufig weniger starke Beschwerden, die manchmal gar nicht als ‚Bruchschmerz‘ wahrgenommen werden. Generell gibt es folgende Möglichkeiten für Symptome, die zumindest den Verdacht auch einen Beckenbruch zulassen:
- Schwellung in der Hüftregion
- Blutergüsse in der Höhe des Beckens
- Gefühl von Instabilität im Bereich des Beckens
- schmerzhafte Bewegungsblockaden
- sicht- oder fühlbare Fehlstellungen der Beckenknochen
Alarmiert sollten sie ferner sein, wenn die genannten Symptome in Kombination mit Gesichtsblässe, Unruhe, Verwirrtheit, schnellem Puls, Bewusstseinstrübungen oder gar Bewusstseinsverlust auftreten. Die Begleitbeschwerden könnten auf innere Blutungen und somit auf beschädigte Organe hinweisen. Es spräche also alles für einen instabilen Bruch. Darüber hinaus ist auch Blut im Urin gelegentlich ein Anzeichen für schwere Beckenbrüche. Melden Sie sich also unbedingt bei Ihrem Arzt, wenn diese Symptome nach einem Sturz oder Unfall auftreten!
Diagnose und Therapie bei einem Beckenbruch
Für die erste Untersuchung durch den Arzt ist besonders der Unfallhergang relevant. Allerdings ist es auch wichtig, dass Sie dem Arzt einen möglichst genauen Überblick über die Beschwerden vermitteln. Der Mediziner wird Ihr Becken womöglich auch vorsichtig abtasten, um festzustellen, ob die Beckenstabilität noch gegeben ist.
Als Diagnosetechnik erster Wahl, um einen möglichen Bruch des Beckenknochens festzustellen, dient das Röntgen. Da gerade bei Unfällen häufig noch andere Teile des Körpers in Mitleidenschaft gezogen werden, besteht zudem die Möglichkeit einer Untersuchung mittels Ultraschall, Computertomographie oder, bei konkretem Verdacht, das Röntgen der Blase mittels Kontrastmittel. Die Diagnose führt in jedem Fall zum Ausarbeiten einer geeigneten Therapie. Diese kann sich wie folgt gestalten:
Schonung: Stabile Beckenbrüche werden üblicherweise nicht operiert. Die Heilungschancen sind gut und lassen sich privat beschleunigen, indem Sie für eine vom Arzt festgelegte Zeitspanne, strenge Bettruhe einhalten. Bewegung und eine dadurch provozierte Mehrbelastung des Beckens ist zu vermeiden, kann Ihr Bruch durch die gezielte Schonung doch schneller heilen. Dies gilt insbesondere für bewegungsstarre Knochenabschnitte im Beckenring, die zur vollständigen Heilung unbedingt in ihren stabilen Ausgangszustand versetzt werden müssen.
Kühlung: Durch stumpfe Gewalteinwirkung kommt es häufig zu unangenehmen Schmerzen in Form von Schwellungen, sowie zu weitläufigen Blutergüssen. Eisbeutel und Eiswickel helfen Ihrem Körper dabei, die Schwellung abklingen zu lassen und das Ausmaß der Blutergüsse zu reduzieren. Achten Sie dabei bitte auf Ihre individuelle Berührungs- und Kälteempfindlichkeit, um weitere Schmerzen zu vermeiden.
Operation: Bei instabilen Formen hiesiger Beckenbrüche wird meistens operiert. Während der Operation wird der Chirurg Ihr Becken durch geeignete Hilfsmittel wieder stabilisieren. Je nach Art und Schwere des Bruches hilft eine äußere Fixierung mit Hilfe einer Beckenzwinge, welche wie eine Art Schraubzwinge die Knochen von außen an Ort und Stelle fixiert halten soll. Auch besteht die Möglichkeit, Platten oder Schrauben zur besseren Stabilisierung am Becken anzubringen.
Medikamente: Je nach Schweregrad der Beckenbrüche kommen unterschiedliche Medikamente zur Behandlung der Schmerzen in Betracht. Bei leichten bis mittelstarken Schmerzen im Zuge einer stabilen Fraktur des Beckens sind nichtsteroidale Antirheumatika wie Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Flufenamin- oder Mefenaminsäure sehr hilfreich. Von Aspirin ist hingegen abzuraten, da die Ayetylsalicylsäure blutverdünnend wirkt, was unliebsame Nebenwirkungen wie Schwellungen, vermehrte Blutergüsse und dadurch erhöhte Druckschmerzen verursachen kann. Bei starken bis sehr starken Schmerzen im Rahmen einer instabilen Beckenfraktur wird Ihr Arzt ein für Sie geeignetes Medikament festlegen, welches möglicherweise aus der Gruppe der Opiate stammt.
Fraktur des Beckens – Tipps und Infos zur Prävention

Natürlich lässt sich ein Beckenbruch nicht pauschal vorbeugend verhindern. Richten Sie Ihren Fokus daher auf die Reduzierung einer Unfallgefahr im Alltag. Das gilt vor allem für Risikobereiche wie Autofahrten, Treppensteigen oder Agieren in großen Höhen, denn Vorsicht ist in diesem Fall die beste Vorbeugung:
- Stolperfallen entfernen – Gerade bei älteren oder sturzgefährdeten Menschen sollten vorbeugende Maßnahmen zur Minimierung der Sturzgefahr ergriffen werden. Hierfür ist es ratsam zu überprüfen, ob es in Ihrer Wohnung Stolperfallen wie Teppiche, Schwellen oder Kabel gibt, die umgelegt oder entfernt werden können. Auch moderate Höhenunterschiede einzelner Treppenstufen sind hier relevant.
- Sehtest – Um auszuschließen, dass ein beeinträchtigtes Sehvermögen der Grund für einen Sturz oder Unfall ist, bietet sich eine augenärztliche Untersuchung an. Auch die motorische Koordinationsfähigkeit der Beine sollte in Augenschein genommen werden, was unter Umständen den Rat eines Orthopäden oder Physiotherapeuten erfordert.
- guter Stand – Ein solides Schuhwerk ist eine gute Präventivmassnahme gegen Unfälle, die dem Becken gefährlich werden können. So verhindern geschlossene, absatzfreie Schuhformen beispielsweise ein Ausrutschen und Wegknicken des Fußes, womit sie erfolgreich Stürze vermeiden.
- Vorsicht im Straßenverkehr – Ob als Fußgänger, Auto- oder Radfahrer. Beachten Sie stets die geltenden Verkehrsregeln und fahren Sie mit moderatem Tempo. Nicht nur, dass Sie durch unverantwortliches Fahrverhalten sich selbst und Ihren Beifahrern unnötige Bruchgefahren zumuten, auch Passanten werden durch einen Mangel an Rücksicht von Autofahrern häufig verletzt. Gleichzeitig ist Leichtsinn bei der Fortbewegung zu Fuß oder Rad ebenfalls nicht zu entschuldigen, da auch Nicht-Autofahrer für Verkehrsunfälle sorgen können, die Bein-, Wirbel- und Beckenbrüche nach sich ziehen.
- Vorsorge gegen Osteoporose: Da ein Beckenbruch oft im Zusammenhang mit Osteoporose steht, ist es ratsam, auch hier präventive Maßnahmen zu treffen, damit es gar nicht erst soweit kommt. Eine der besten Vorsorgemaßnahmen ist sicherlich die Einnahme von Kalzium, welches maßgeblich an der Gesundheit unserer Knochen beteiligt ist. Zu viel Kalzium kann Ihrem Organismus allerdings schaden, deshalb sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, wie viel Kalzium sinnvoll ist und in welcher Form Sie es nehmen sollten. Auch Magnesium spielt bei der Knochengesundheit eine wichtige Rolle, ebenso wie Vitamin D, denn dank jenem kann das Kalzium überhaupt aus dem Darm aufgenommen werden.
Fazit
Die Gefahr eines Unfalles oder eines unglücklichen Sturzes begleitet einen täglich, was das Risiko eines Beckenbruchs natürlich niemals gänzlich ausschließt. Eine entsprechende Fraktur ist dabei ganz sicher nicht angenehm und geht meist mit Schmerzen, gelegentlich sogar mit dauerhaftem Stabilitätsverlust einher. Dank guter ärztlicher Betreuung, nutzbringenden Schmerzmedikamenten, sowie gezielter Schonung durch Bettruhe können Sie die Zeit bis zur Heilung aber überstehen und diese tatkräftig unterstützen. Mit erhöhter Achtsamkeit können Sie darüber hinaus vorab gefährliche Situationen frühzeitig erkennen und vermeiden, sodass es erst gar nicht zum Beckenbruch kommt.







